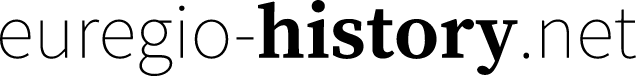Am 10. April 1940 – dem Tag des Einmarsches der deutschen Wehrmacht in die Niederlande – wurde ich in Bocholt, an der Dinxperloerstraße, geboren. Mein älterer Bruder erinnert sich gut an den Einmarsch: Die Soldaten sind direkt an der Haustür vorbeimarschiert. Zwei weitere Brüder, Halbgeschwister, waren eingezogen worden und nahmen als Soldaten am Krieg teil.
In den letzten Kriegstagen floh der Teil der Familie, der noch in Bocholt lebte, aus der Stadt. Die Bunkeranlage im Rosenberg, wo wir jeweils Schutz vor den Fliegerangriffen gesucht hatten, war zerstört wurden. Die Erinnerungen an die Flucht gehört zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen. Unter Bombenhagel gelangten wir in eine Bauernschaft, nach Rhede und Oeding. Warum wir dann alle in Vreden gelandet sind? Mein Vater – er war Sanitäter – kannte sich durch seine Tätigkeit auch im weiteren Umkreis aus. Hier in Vreden waren auch Bekannte: Der Stadtdirektor Visser und der Fabrikant Hüsker. Deshalb sind wir im Bombenhagel nach Vreden gezogen.
Mein Vater hatte am 1. Weltkrieg teilgenommen; im 2. Weltkrieg war er nicht als Soldat aktiv, blieb in Bocholt und konnte sich um seine Familie kümmern. Als Sanitäter wirkte er auch am Rosenberg im dortigen Behelfsheim. Er gehörte der SA an, war Standartenführer, eine ziemlich hohe Funktion. Zu der Zeit ist er einfach mitgeschwommen und hat auf diese Weise seine Familie durchgebracht. – In Vreden dann Amt als Städtischer Gärtner bekommen.
Im Winter 1946 lebten wir in einem kleinen Hühnerstall auf dem Gelände der Villa von Hüsker. In der Villa waren Engländer einquartiert. Jemand rief mich Adolf – ich weinte, weil ich dachte, die Engländer würden das hören. Viel lieber hatte ich es, wenn man mich Adi nannte. Eine weitere Erinnerung aus dieser Zeit ist, dass hier ein ganz anderes Plattdeutsch gesprochen wurde als in Bocholt.
In Vreden gab es nach dem Krieg nur zwei Arbeitsorte: die Textilfabriken von Hüsker und von Häckin. Wenn da nicht bereits die ganze Familie arbeitete, kam man nicht rein. Die meisten mussten auswärts arbeiten.
So habe ich am 13.7.1955 im Bergbau angefangen. Auf der Zeche Marl-Brassert habe ich eine Lehre absolviert. Als die erste Kohlenkrise kam, wurde ich als Junggeselle von Brassert nach Bottrop zur Zeche Prosper verlegt. Der Arbeitsweg dauerte jeweils 1 1/2 Stunden – sowohl der Hin- wie der Rückweg. Auf der Zeche wurde in drei Schichten gearbeitet. Das Busunternehmen brachte die einen hin und nahm die anderen wieder mit. Holländer gab es dort kaum, aber etliche Bayern.
Nach sieben Monaten auf Prosper wurde ich 1959 entlassen und habe dann jede Arbeit angenommen, die ich kriegen konnte. Ein Staubsaugervertreter, der an unserer Tür klingelte, meinte, wenn wir ein Gerät kauften, würde er mir eine Arbeit besorgen. So kam ich in die Textilspinnerei Eilermark in Glanerbrug. Dort habe ich dann drei, vier Jahre gearbeitet; es gab viele Holländer, die auch dort arbeiteten. Einer der Holländer erzählte, dass er zu Wehrmachtszeit bei der SS war.
Ich habe so lange gespart, bis ich 1962 den LKW-Führerschein machen konnte. Zuerst machte ich die Kohlenarbeit, dann bin ich Grenzverkehr gefahren. In Vreden gab es zu dieser Zeit die zwei Textilfabriken Hüsker und Häckin und die Firmen Saueressig und Dula aus Dortmund (stellen bis heute Möbel für Ladeneinrichtungen her). Eine Speditionsfirma – die Spedition Konrad Verwohlt in Vreden – ist für diese vier Firmen gefahren. Als ich angefangen habe, waren es vier Fahrer. Als Fahreranfänger musste man erst mal ein halbes Jahr Kohlenschleppen. Die Kohle kam mit der Bahn. Alles musste geschleppt werden, es gab keinen Stapler und keinen Hubwagen.
Das Foto mit dem LKW stammt von 1962. Mit diesem Wagen wurden alle Waren spediert; dazu hatte kamen noch zwei Möbelwagen, mit denen man für Hülsta aus Stadtlohn gefahren ist. Wir fuhren immer zu zweit. Einer hat geschlafen, der andere ist gefahren. Der Verdienst war nicht hoch. Bei Pannen hat man sich selbstverständlich geholfen.
Die Grenzkontrollen waren früher sehr hart: Wenn eine Birne fehlte und das Licht nicht funktionierte, musste man 35 Mark bezahlen und wurde ins schwarze Buch eingetragen. Am Grenzübergang bei Oeding, Glanerbrug und Gronau musste man aussteigen und die Papiere vorlegen. Die Tankfüllung wurde mit einem Zollstock nachgemessen: Auch der Tankinhalt musste dann verzollt werden. Die Zulassung des LKW wurde kontrolliert, die Zollbescheinigungen. An der Grenze gab es Spediteure, die für uns Fahrer das erledigten, das konnte dauern. Bei Emmerich dauerte dieses Prozedere sicher ein paar Stunden. An der polnischen Grenze standen wir manchmal tagelang. Auf der Fahrt nach Berlin wurde an der damaligen innerdeutschen Grenze sogar die Butterdose kontrolliert. Autobahnen gab es noch wenige; wir sind früher durch alle Städte hindurchgefahren. Für Hülsta bin ich bis nach Dänemark und Belgien gefahren; zuletzt bin ich regelmäßig nur noch nach Holland gefahren.
Ich habe bei meinen Fahrten nicht viel andere Sprachen benötigt: Ich spreche Vredener Platt und mit Händen und Füssen kommt man überall durch.